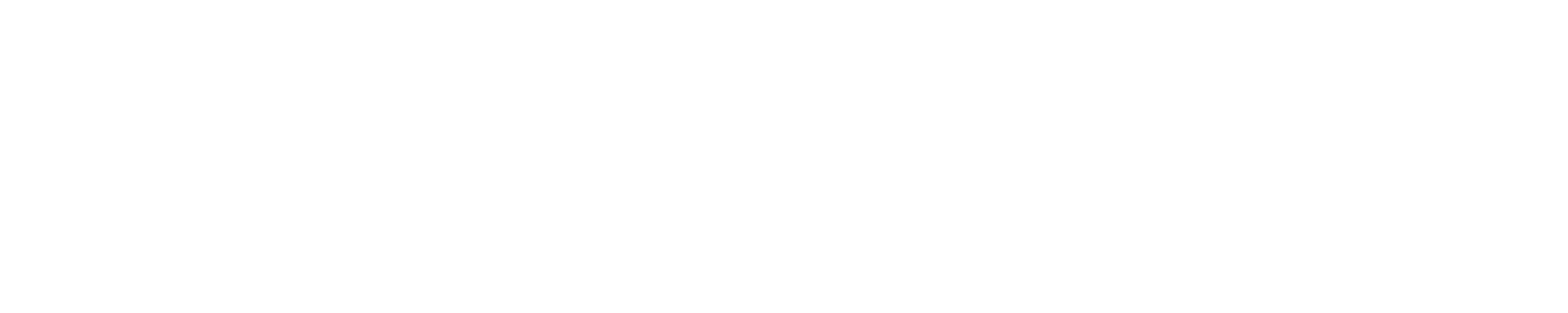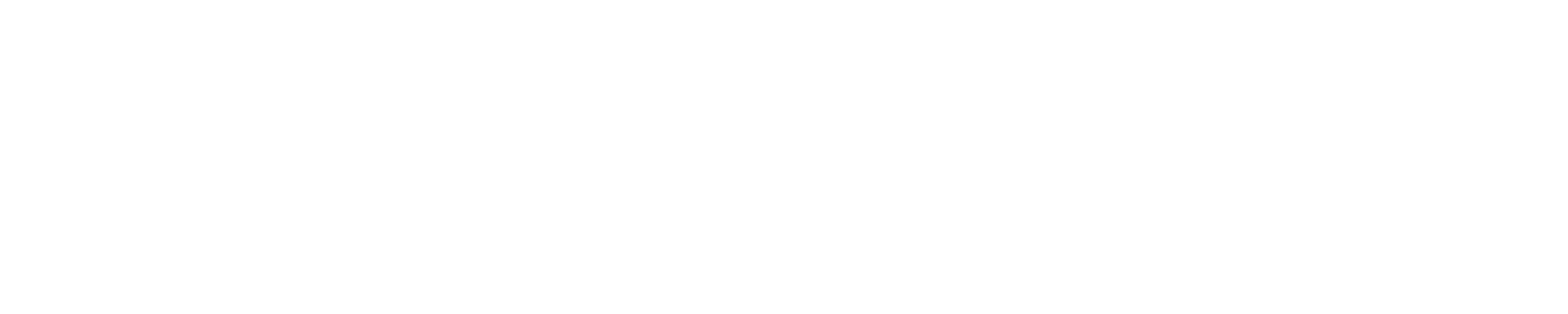Johann Strauß – der Walzerkönig
Der Aufstieg der Strauß-Dynastie zur Weltherrschaft
Es gibt wenig musikalische Wahrzeichen, die weltweit so eindeutig identifiziert werden wie der Walzerrhythmus mit der Stadt Wien. Johann Strauß und seine Dynastie sind zum Inbegriff der wienerischen Kultur geworden, die in ihrer Eigenart die ganze Welt erobern konnte. Ihr kometenhafter Aufstieg begann recht bescheiden.
Es war die Ära des Wiener Kongresses nach dem Sieg der alten Mächte über Napoleon. „Der Kongreß tanzt“, hieß das Schlagwort. Und tatsächlich tanzte man in jenen Jahren in Wien leidenschaftlich. Es war die Ära, als der „neue“ Walzer wienerischer Prägung, ein rascher, zündender Nachfahre des ländlichen steirischen und oberösterreichischen „Deutschen“ oder „Ländlers“, die Parkette eroberte.
Aus den kleinen Musikergruppen, die oft nur zu dritt – zwei Geiger und ein Gitarrist – in Wiener Lokalen zum Tanz „und fürs Gemüt“ aufgespielt hatten, wurden bald Tanzorchester. Joseph Lanner und Johann Strauß heißen die führenden Köpfe. Man braucht deren mehrere, denn die Tanzlust der Wiener wird bald unersättlich.
Es herrscht Freude an den wienerischen Walzern, die sich nach dem Vorbild von Carl Maria von Webers „Aufforderung zum Tanz“ bald in ihrer später sakrosankten Form präsentieren – eine stimmungsvolle Einleitung, fünf Walzer mit jeweils zwei melodischen Themen – und eine Schluß-Steigerung. Man will diese Musik auch im Konzert hören.
Da präsentiert sich Johann Strauß Vater, der Begründer der Dynastie, als perfekter Orchesterleiter. Sein Ensemble ist nach übereinstimmender Aussage kritischer Zeitgenossen das technisch beste Wiens. Man musiziert nicht nur Tanzmusik, sondern Beethovensymphonien und Mozart, aber auch die neuesten Stücke zeitgenössischer Komponisten. Die Unterscheidung in „Ernstes“ und „Unterhaltendes“ hat man noch nicht getroffen. Meister vom Rang eines Hector Berlioz oder Richard Wagner staunen über die Qualität der Strauß’schen Konzerte.
Strauß ist der Erfinder des Reise-Orchesters
Solche Qualität läßt sich vermarkten. Tatsächlich ist Johann Strauß nicht nur der Erfinder der perfekten symphonischen Wiedergabe, sondern auch des Reise-Orchesters. Seine Tourneen werden zu Sensationen – auch im übrigen Europa will man das Wunder von Wien bestaunen – und bezahlt dem findigen Strauß Gagen in exorbitanten Höhen. Die Söhne Johann, Joseph und Eduard, die zunächst gegen den Willen des Vaters zu Musikern werden, übernehmen ein bereits europaweit erfolgreiches Unternehmen. Wie der Papa wird Johann Strauß Sohn nach dessen frühem Tod zum unbestrittenen „Walzerkönig“ und reist mit seinem Orchester um die Welt.
Bald ruft sogar der damals so reiche, omnipotente russische Zarenhof. Die Wiener Walzerkonzerte wechseln jeden Sommer zur „Außenstelle“ nach Pawlowsk in der Nähe von St. Petersburg. Das Walzerkomponieren und -musizieren ist zu einem einträglichen Millionen-Geschäft geworden. Komponiert wird beinah am Fließband –
Arbeit genug für drei Brüder ist stets vorhanden – musiziert aber immer auf allerhöchstem Niveau. Das ist man sich und seiner Reputation schuldig.
Sie müssen Operetten schreiben!
Fehlt nur noch die einträglichste Einnahmequelle, die es im musikalischen Business bis in unsere Tage gibt: das Theater! Dieses aber ist in Sachen Unterhaltungsmusik fest in französischer Hand. „Sie müssen Operetten schreiben“, soll Jacques Offenbach, der unbestrittene Meister jenes Genres, zu Johann Strauß gesagt haben. Das ist angesichts der Publikumserfolge, die seit geraumer Zeit auch in Wien mit der neuen, in Paris erfundenen Gattung Operette gemacht werden, ein allgemeiner Wunsch in der Heimatstadt von Strauß. – Wer außer Strauß könnte dem scheinbar so typisch französischen Unterhaltungstheater in echt wienerischer Weise Konkurrenz machen? Operette, das ist die zynisch-zeitgeistige Abendunterhaltung im Paris von Napoleon III., prickelnd wie Champagner, frivol, ein bißchen „unter der Gürtellinie“ – sowohl was die Zurschaustellung der Reize der Ballett-Tänzerinnen als auch zahllose Textpassagen mit Anspielungen auf die Politik betrifft. Der Ruhm der neuen Theatergattung dringt selbstredend bald von Frankreich ins nicht minder vergnügungssüchtige Österreich. An der Wiege der Operettenerfolge in Wien steht niemand Geringerer als das Theatergenie Johann Nestroy, das selbstverständlich Bescheid weiß um die Mentalitätsunterschiede. Es ist eines, auf einer Pariser Bühne einen gekonnten politischen Seitenhieb zu servieren, es ist etwas ganz anderes, in Wien über das Allerhöchste Erzhaus zu lästern!
Nestroy, nicht zimperlich im Umgang mit Behörden, Obrigkeiten und Zensoren, weiß, was in Wien möglich ist, und was nicht. Seine Mitarbeiter besorgen daher entsprechende „Einrichtungen“ Offenbachscher Kompositionen. „Hochzeit im Laternenschein“, 1858, ist die erste Operette in Wien, 1860 erscheint „Orpheus in der Unterwelt“. Nestroy persönlich gibt den Jupiter! Der Cancan wird sofort zum Modetanz, mit dem sich die Besucher der Ballsäle redlich abmühen.
Der Wiener Operetten-Stil hat bald auch einen Namen: Marie Geistinger. Die schöne, dem Zeitgeschmack entsprechend übrigens nicht gerade dünnleibige Künstlerin aus Graz verfügt über eine angenehme, wendige Sopranstimme, vor allem aber über ein gerüttelt Maß an Lockerheit und Freizügigkeit, um ihren Figuren auf der Bühne nicht nur künstlerisches, sondern auch erotisierendes Profil zu verleihen. Eine effektive Mischung aus durchaus berechtigtem Kunstanspruch und dem gekonnten Spiel mit etwas niedriger angesiedelten Instinkten macht die Faszination der Geistinger aus. Sie ist Wiens erste „Schöne Helena“.
Am 17. März 1865 steht Jacques Offenbach höchstselbst am Pult, als die Geistinger die für sie wie maßgeschneiderte Rolle in Wien aus der Taufe hebt. Die Konkurrenz schläft nicht. Am Carltheater ist die Intimfeindin der Geistinger engagiert, Josefine Gallmeyer. Nicht minder freizügig, nicht minder schön anzuschauen und, wenn man den Berichten glauben darf, auch künstlerisch ebenso talentiert, allerdings weniger diszipliniert. Extemporierend legt sie schon einmal einen Theaterabend lahm. Operette ist jedenfalls die modische neue Unterhaltung in der Musikstadt Wien. Offenbach dominiert, allen Versuchen von Suppé, Millöcker und Co. zum Trotz.
Strauß sollte Offenbach Paroli bieten
Wer außer Johann Strauß, ebenso unumschränkter König der Tanzmusik, könnte dem also Paroli bieten? Strauß und niemand anderer als er musste die wienerische Antwort auf diese französische Landnahme formulieren. Darüber ist sich ganz Wien im Klaren. Ganz Wien, nur offenbar einer nicht: Johann Strauß selbst. Er bleibt seinen Walzern, Polkas, seinem Ball- und Konzertorchester treu. Die lukrativsten Theaterangebote holen ihn nicht aus der Reserve. Wie so oft sind es auch in diesem Fall die Damen, die das Eis brechen. Henriette Strauß stiehlt ihrem Mann Manuskripte von Tanzsätzen aus den Schreibtischladen und läßt die Walzer- und Polka-Entwürfe textieren. Die so für die Bühne tauglich gemachten Melodien werden im „Theater an der Wien“ erstmals vorgeführt – und zwar vor leerem Auditorium. Johann Strauß selbst und die Urheber der Intrige sind – wie der Bayernkönig Ludwig II. bei Münchner Wagner-Aufführungen – allein im Zuschauerraum anwesend. Man wartet gespannt auf das Urteil des Meisters; und er ist – begeistert.
Was die Theaterleiter Wiens angesichts der beharrlichen Operetten-Enthaltsamkeit von Strauß nicht mehr zu hoffen wagten, tritt ein – der Walzerkönig beginnt ernsthaft, sein erste Operette zu skizzieren. Während der letzten Sommersaison, die der Meister in Pawlowsk verbringt, arbeitet er bereits an einer Musik auf ein Libretto namens „Die lustigen Weiber von Wien“. Schließlich soll doch die Geschichte der echten „Wiener Operette“ mit einem wienerischen Thema beginnen. Auch eine ideale Interpretin der Wiener Volkssängerin, der die Hauptrolle in den „Lustigen Weibern“ zugedacht ist, hat man im Visier: Josefine Gallmeyer soll es sein. Die aber ist mit Marie Geistinger, die mittlerweile Prinzipalin des Theaters an der Wien geworden ist, immer noch tödlich verfeindet. So scheitert, die Gerüchteküche will es wissen, dieses allererste Strauß’sche Operettenprojekt angeblich am Hass der Primadonnen! Die Geistinger kann aber die Uraufführung der ersten Strauß-Operette für sich und ihr Haus verbuchen. Natürlich singt sie selbst in der Premiere die weibliche Hauptrolle, die Fantasca in „Indigo und die vierzig Räuber“.
Sehnsüchtig hat Wien auf dieses Ereignis gewartet. Die Vorberichte der Presse nehmen das Format heutiger PR-Lawinen an. Strauß selbst lässt bereits im Jänner 1871, als klar ist, welchem Werk sein Operetteneinstand gelten wird, eine Walzerfolge aus der Bühnen-Novität avisieren, um das Publikum mit dem Titel des Stücks vertraut zu machen und die Neugier nach den Melodien zu schüren.
Indigo wird ein Triumph
„Indigo“ wird ein Triumph. Nicht von allen Strauß-Operetten, die folgen, kann man das behaupten. Die Praxis aber, Melodien aus neuen Operetten zu Walzern zu verarbeiten, wird ab sofort das Repertoire der Strauß-Kapelle bereichern und den letzten Karriere-Schub des Walzerkönigs begleiten. Und manche Melodie, die aufgrund problematischer Texte und schwacher Dramaturgie via Bühne nie die Welt erobern könnte, lebt als Konzertwalzer ewig: Nicht nur der „Schatzwalzer“ aus dem „Zigeunerbaron“ oder der Lagunenwalzer aus der „Nacht in Venedig“, sondern beispielsweise auch die „Rosen aus dem Süden“ aus dem „Spitzentuch der Königin“ gehören bis heute zum Fixbestand des wienerischen Musikrepertoires in aller Welt.
Nun fehlte nur noch Amerika
Nun hatte der Walzer Europa inklusive Russlands und das Musiktheater erobert. Fehlte nur noch Amerika. Patrick Sarsfield Gilmore, vom einfachen Musikanten, der in verschiedenen Blaskapellen Trompete geblasen hat, zum einflussreichen Veranstalter aufgestiegen, will Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts in Boston ein Weltfriedensfest ausrichten.
 Welches internationale Zugpferd könnte die erhofften Zigtausende von Besuchern anlocken? Gilmore reist nach Österreich und ködert den zunächst äußerst skeptischen Komponisten: 2000 Musiker sollen unter seiner Leitung den Donauwalzer spielen. 100.000 Dollar Honorar, eine für den damaligen Durchschnittsbürger unvorstellbar hohe Summe, soll Gilmore bei einer Wiener Bank deponiert haben, so wissen Wohlinformierte zu berichten. Auf der „Bremen“ reist Strauß über den Ozean nach New York. Alles ist organisiert wie bei einem modernen Star-Event. Am Tag der Ankunft in Boston, dem 16. Juni, findet bereits die erste Probe statt. 2000 Musiker sind es zwar nicht geworden, die endgültige Zahl wird von den Kommentatoren auf etwa 800 geschätzt. Aber immerhin, etwa 200 Erste Violinen und 80 Violoncelli intonieren die berühmte erste Walzermelodie „An der schönen blauen Donau“.
Welches internationale Zugpferd könnte die erhofften Zigtausende von Besuchern anlocken? Gilmore reist nach Österreich und ködert den zunächst äußerst skeptischen Komponisten: 2000 Musiker sollen unter seiner Leitung den Donauwalzer spielen. 100.000 Dollar Honorar, eine für den damaligen Durchschnittsbürger unvorstellbar hohe Summe, soll Gilmore bei einer Wiener Bank deponiert haben, so wissen Wohlinformierte zu berichten. Auf der „Bremen“ reist Strauß über den Ozean nach New York. Alles ist organisiert wie bei einem modernen Star-Event. Am Tag der Ankunft in Boston, dem 16. Juni, findet bereits die erste Probe statt. 2000 Musiker sind es zwar nicht geworden, die endgültige Zahl wird von den Kommentatoren auf etwa 800 geschätzt. Aber immerhin, etwa 200 Erste Violinen und 80 Violoncelli intonieren die berühmte erste Walzermelodie „An der schönen blauen Donau“.
Amerika, das sprichwörtliche Land der unbegrenzten Möglichkeiten, kreiert unter der Stabführung von Johann Strauß und einigen Subdirigenten so etwas wie den „unbegrenzten Klang“. Die wienerische Unterhaltungsmusik ist endgültig universal geworden.
Wilhelm Sinkovicz, Wien für die K&K Philharmoniker
»An der schönen blauen Donau«
Aufzeichnung der Wiener Johann Strauß-Konzert-Gala beim Dänischen Rundfunk im Konzerthaus Kopenhagen.
 Hello
Hello